
Einflussfaktoren verstehen und den baulichen Gesundheitsschutz gezielt umsetzen
Damit die Bauplanung den baulichen Gesundheitsschutz berücksichtigen und effektiv umsetzen kann, muss zunächst verstanden werden, welche Risikofaktoren bezüglich der Gesundheit und des Wohlbefindens der Nutzenden einer Einrichtung bestehen. Im nächsten Schritt müssen die passenden Maßnahmen in den verschiedenen Planungsphasen ergriffen werden. Diese Seite bietet einen Überblick über das die zu beachtenden Einflussfaktoren.
Der Bau von Gebäuden, in denen infektionspräventive Prozesse möglich gemacht werden, ist eine gemeinsame Verantwortung von Eigentümer*innen, Architekt*innen und Planenden. Dabei können nicht alle Maßnahmen die Verbreitung aller Infektionserreger aufgrund ihrer unterschiedlichen Übertragungswege und biologischen Eigenschaften gleichermaßen verhindern. Auch müssen die Nutzendenprofile der geplanten Infrastruktur beachtet werden. Denn das Infektionsrisiko setzt sich aus mehreren sich teilweise gegenseitig bedingenden personen-, raum- und prozessbezogenen Faktoren zusammen, die bei der Planung zu beachten sind und im Folgenden dargestellt werden.
- Alter, Aktivitätsgrad, Beweglichkeit
- Grunderkrankungen
- Gesundheits- und Hygienekompetenz (z. B. korrektes Maskentragen)
- Impfstatus
- Kontakte zu Freund*innen, Familie, Kolleg*innen etc.
- Besucherverkehr
- Aufenthaltszeit
- Menge der ausgeschiedenen Erreger durch Infektionsquelle
- Nähe/Art des Kontaktes
- Bildungsgrad zum Thema Hygiene
- Personalmangel
- Impfstatus
- Aufenthaltszeit
- Räumliche Bedingungen (z. B. Größe, Personendichte, Möglichkeiten zur Kohortierung)
- Belegung und Möglichkeiten zur zeitlichen Staffelung
- Belüftungsverhältnisse und Monitoring der Belüftung
- Übertragungsweg
- Pathogenität/Virulenz
- Resistenzen
- Impfpräventabilität
- Umweltpersistenz
- Existenz einer Hygieneordnung/eines Hygieneleitfadens
- Vorhandensein von Beauftragten für Hygiene
- Vorgaben von Behörden/des Trägers
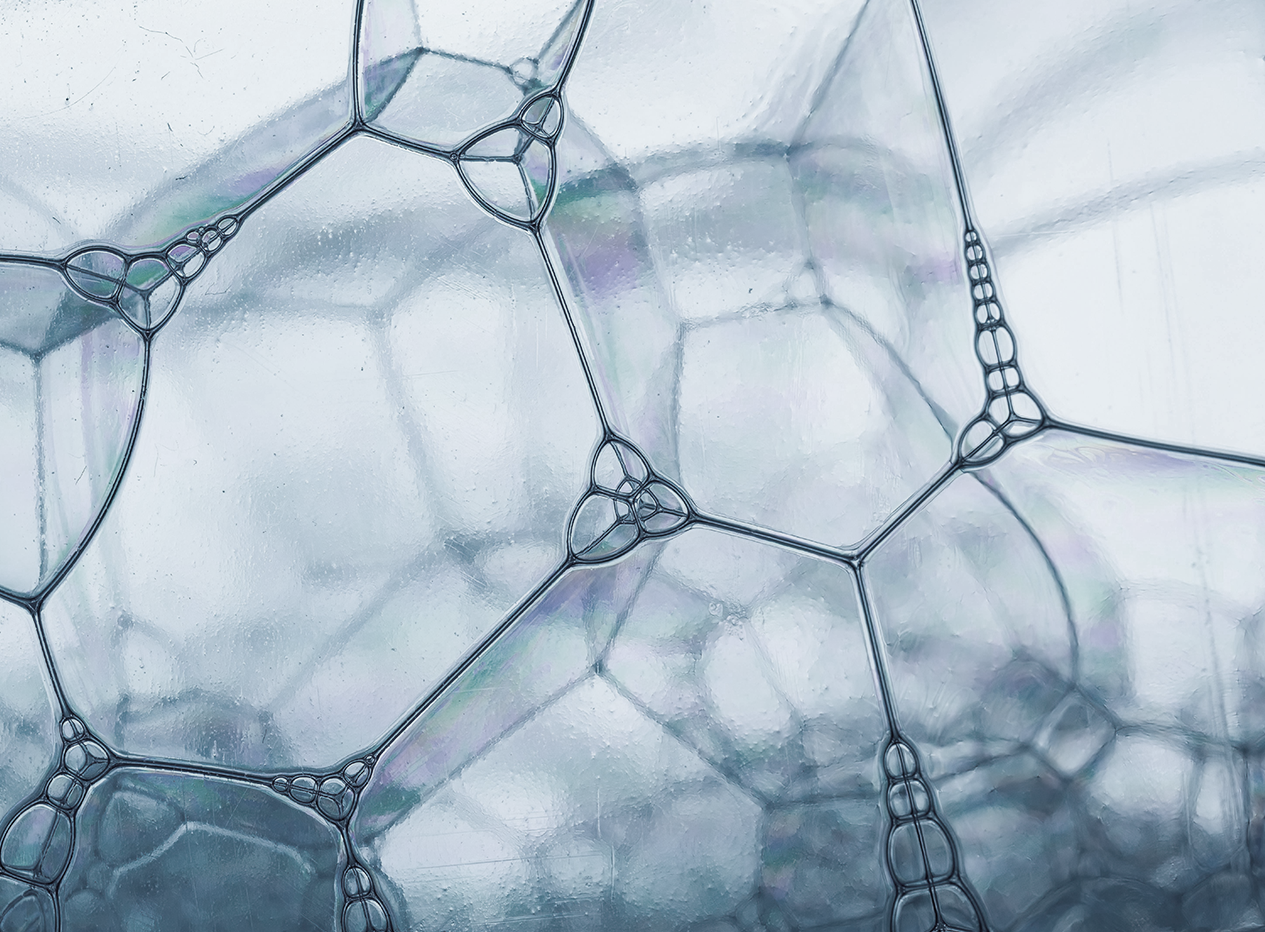
Hier gibt es mehr Informationen dazu, wie Erreger übertragen werden, welche Erreger wo berücksichtigt werden sollten, und zu weiteren baurelevanten Themen der Hygiene.
Die folgende Liste umfasst eine Auswahl möglicher Einflussfaktoren für die Prävention von Luft-, Tröpfchen- und Kontakt-übertragbaren Erregern, die sich auf die Architektur, Lüftungstechnik und Materialwahl auswirken können. Die Liste ist nicht nach Effektivität geordnet, da diese u. a. von den Nutzendenprofilen, räumlichen Voraussetzungen und den vorkommenden Erregern abhängt. Es gibt Standardhygienemaßnahmen, die dauerhaft präventiv angewandt werden sollten, bzw. ergänzende Maßnahmen, um spezifisch und zielgerichtet auf ein erhöhtes lokales oder pandemisches Infektionsgeschehen reagieren zu können. Folgende Beispiele veranschaulichen, wie der bauliche Gesundheitsschutz Einfluss auf das Infektionsrisiko nehmen kann.
Wenn die zum Warten vorgesehenen Flächen einer Arztpraxis dem Organisationsprozess der Praxis entsprechen, können dicht gedrängte Menschengruppen vermieden und das Infektionsrisiko reduziert werden.
Separate Wartezimmer in Arztpraxen für Patient*innen mit und ohne Infektionsverdacht können das Infektionsrisiko für die Anwesenden senken.
Der Einsatz einer den Vorgaben und eine dem baulichen Gesundheitsschutz entsprechend gewartete maschinelle Belüftung kann das Infektionsrisiko durch luftgetragene Infektionserreger senken.
Die Einhaltung eines Mindestabstandes, vor allem zwischen Lehrer*in und Schüler*innen, unterstützt durch geeignete Tischpositionierung, kann das Infektionsrisiko im Nahfeld senken. Ein Abstandhalten der Schüler*innen untereinander wäre ebenfalls günstig. Hierzu müssen die Klassenräume ausreichend groß geplant werden.
Eine geeignete Ausstattung kann infektionspräventive Prozesse erleichtern. In Arztpraxen sollen beispielsweise Händedesinfektionsmittelspender möglichst nahe (in Armlängenabstand) am Arbeitsplatz der Mitarbeiter*innen angebracht werden.
Die Struktur eines Altenheimgrundrisses kann durch eine getrennte und gezielte Prozess- und Wegeführung dazu beitragen, dass Übertragungen von Erregern bspw. über Pflegehilfsmittel von einer Wohneinheit in die andere Wohneinheit vermieden werden.
» Besonders da, wo viele Menschen auf engem Raum zusammentreffen, spielt Gesundheit eine entscheidende Rolle. Prognosen zufolge werden in den nächsten 30 Jahren noch 2 Milliarden Menschen in Städte ziehen oder hineingeboren werden. Im baulichen Gesundheitsschutz sehe ich eine große Chance für die „gesunde Stadt der Zukunft“ «
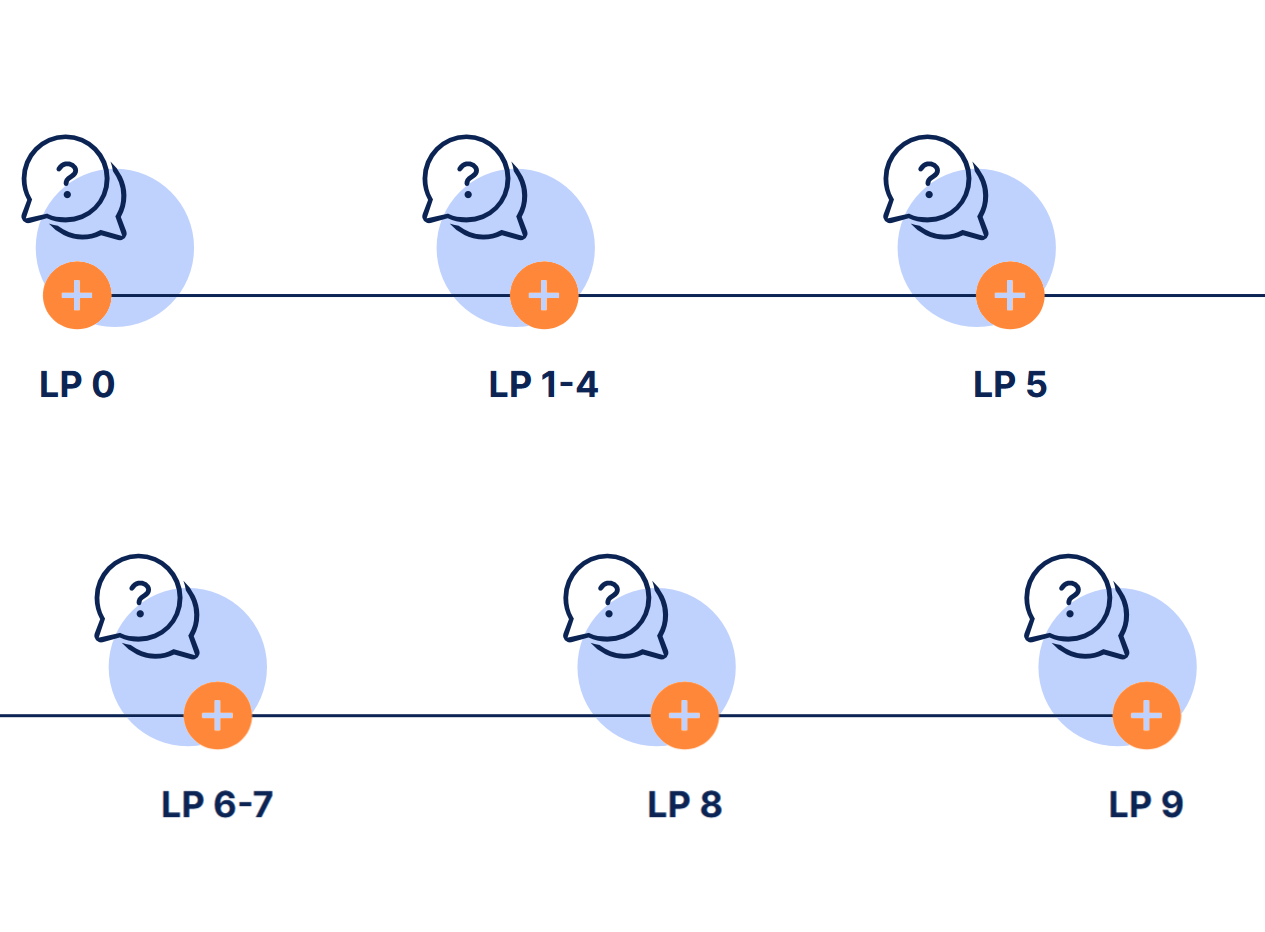
Wie kann der Bau Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzenden ausüben und wie geht man in den einzelnen Phasen der Planung vor, um den baulichen Gesundheitsschutz umzusetzen?

PlanGesund wird von einem multidisziplinären Team aus Wissenschaftler*innen aus den Bereichen der Hygiene und Umweltmedizin, der Lüftungs- und Gebäudetechnik, der Architektur, des Designs und der Materialwissenschaften betrieben.