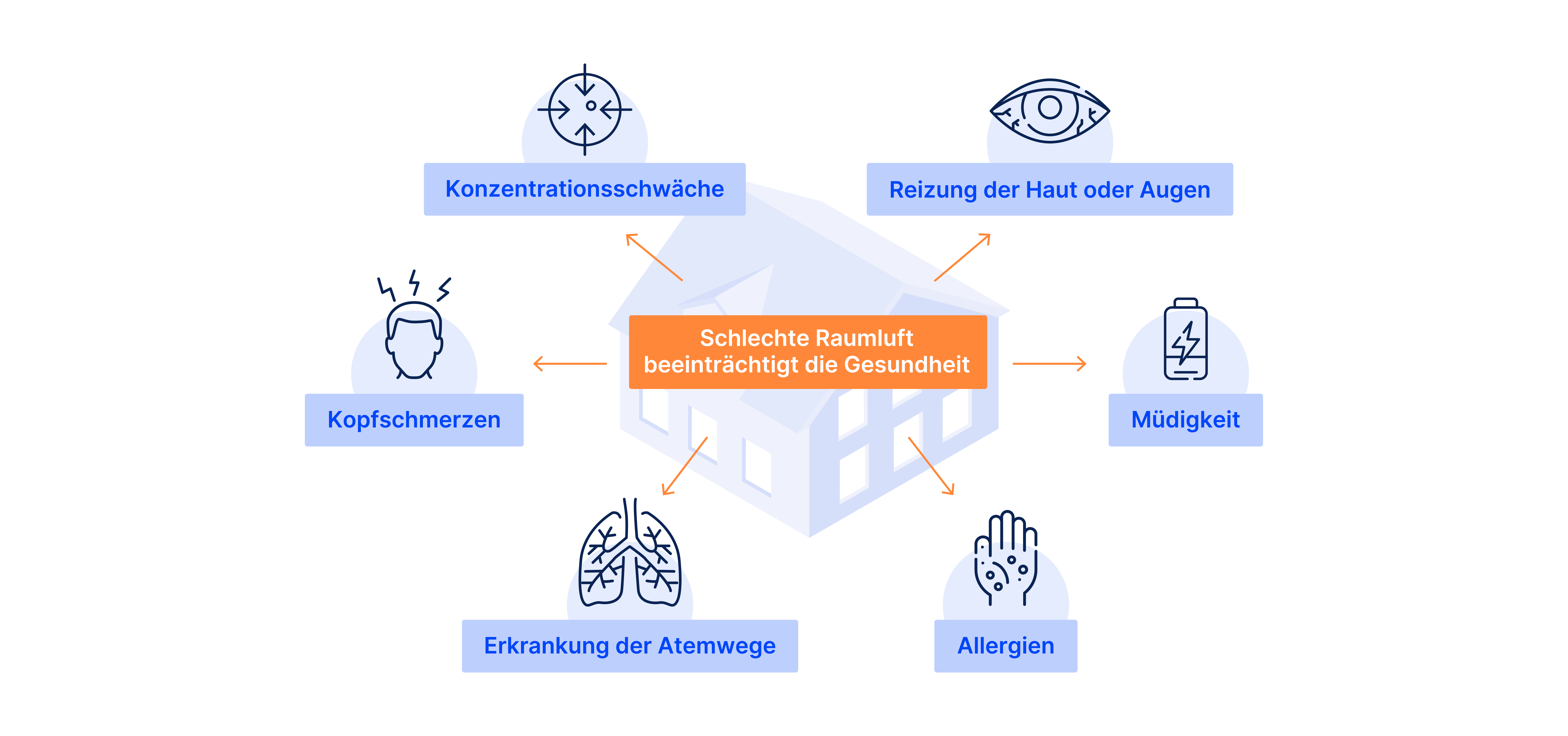Lüftungstechnische Empfehlungen zur Verringerung des Infektionsrisikos
Eine verbesserte Belüftung kann ein Schlüsselelement zur Begrenzung der Übertragung von luftgetragenen Krankheitserregern sein. In der Praxis verringern oder verhindern lüftungstechnische Maßnahmen bereits erfolgreich die Kontamination von Produkten und/oder Personen. Beispiele hierfür sind im Gesundheitswesen (z. B. Isolierstation, OP-Raum, Medikamentenproduktion), in der Lebensmittelindustrie (Verarbeitung und Verpackung), allgemein in biologischen und chemischen Laboren und in der Elektronikverarbeitung (z. B. Computerchips, Elektronikbauteilverarbeitung) zu finden. Im Folgenden werden Empfehlungen gegeben, wie das Infektionsrisiko durch lüftungstechnische Maßnahmen verringert werden kann.
In Bezug auf luftgetragene Krankheitserreger in alltäglichen Räumen lauten die generellen Empfehlungen:
1. Permanente Kontrolle der Luftqualität
Eine permanente Kontrolle der Luftqualität mittels CO2-Sensoren sollte in jedem Fall durchgeführt werden, unabhängig der Be-/Entlüftungsart. Für die Raumnutzenden ist die Qualität der Raumluft gut sichtbar darzustellen. Eingesetzte CO2-Sensoren sollten Mindeststandards hinsichtlich Genauigkeit im Messbereich, Verwendungsort, Einsatzdauer und Datenspeicherung erfüllen.
2. Basisraumlufthygiene
Eine Basisraumlufthygiene sollte jederzeit, unabhängig einer Infektionswelle, eingehalten werden. Diese ist in der Regel gewährleistet, wenn der CO2-Gehalt < 1.000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit liegt (kurzzeitige Überschreitungen sind zulässig).
- Wenn der CO2-Gehalt mehrere Minuten oder gar im Mittel über die Aufenthaltszeit > 1.000 ppm liegt, ist die Lüftung unmittelbar zu überprüfen und Maßnahmen sind zu ergreifen, z. B. Lüftungsmöglichkeiten erhöhen, Personenanzahl begrenzen, Aufenthaltszeit verringern.
- Liegt der CO2-Gehalt > 2.000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit, sollte der Raum ohne weitere Maßnahmen nicht genutzt werden.
3. Raumlufthygiene während einer Infektionswelle
Während einer Infektionswelle sollte auf eine verbesserte Raumlufthygiene geachtet werden:
- Der CO2-Gehalt sollte im Mittel über die Aufenthaltszeit < 800 ppm betragen (kurzzeitige Überschreitungen bis 1.000 ppm sind möglich).
- Zusätzliche Maßnahmen sind zu ergreifen, z. B. Aufenthaltszeiten verringern, Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz / FFP2-Maske.
-
4. Zuführung von „virenfreier“ Luft
Je höher die einem Raum zugeführte „virenfreie“ Luft und damit die Abfuhr potenziell virenhaltiger Luft ist, desto geringer ist das Infektionsrisiko im Nah- und Fernfeld. Dieser Zusammenhang kann als direkt proportional angenommen werden. Wird z. B. der Zuluftvolumenstrom verdoppelt, halbiert sich das Infektionsrisiko.
5. Präventionswirkung verschiedener Be- und Entlüftungsmaßnahmen
Folgende Priorisierung der Be- und Entlüftungsmaßnahmen hinsichtlich der Sicherstellung einer Präventionswirkung gilt (von geeignet bis weniger geeignet):
- Maschinell -> Hybrid -> Natürlich
- Wenn maschinell, dann gilt: Quell-/Schichtlüftung ist effizienter als Mischlüftung.
- Wenn natürlich, dann sind motorunterstützte automatische Fensteröffnungen (z. B. nach CO2-Gehalt gesteuert) besser als rein manuell zu bedienende Fensterflächen.
- Wenn natürlich, dann führt Dauerlüftung (z. B. Kipplüftung) zu einer kontinuierlich besseren Raumluftqualität als Stoßlüftung. Zu öffnende Oberlichter verlängern die Möglichkeit der Offenhaltung bei geringer werdenden Außentemperaturen und sind aus Sicht der Prävention besser geeignet als Kipp-/Drehflügelfenster.
- Die Belüftung mit Außenluft ist der reinen Umluftfilterung vorzuziehen, da neben partikulären Belastungen, wozu Viren zählen, auch gasförmige Schadstoffe, wie CO2, Feuchte, VOC, aus dem Raum abgeführt werden.
- Umluftfiltergeräte ersetzen nicht die Anforderungen an den maximalen CO2-Gehalt. Sie können als ergänzende Maßnahme oder Interimsmaßnahme bei Mischströmung eingesetzt werden.
6. Berücksichtigung der thermischen Behaglichkeit
Bei der Auswahl und beim Betrieb der Be- und Entlüftung ist nachzuweisen, dass während der gesamten Aufenthaltszeit von Personen im Raum neben den CO2-Grenzwerten auch die thermische Behaglichkeit eingehalten wird.
Die generellen Empfehlungen gelten für alle im Projekt betrachteten Infrastrukturen. Eine Unterscheidung ist lediglich hinsichtlich der Querkontamination zwischen den Räumen innerhalb der jeweiligen Nutzungsart sinnvoll. Unter Querkontamination wird die Ausbreitung von Krankheitserregern verstanden, die vom Ursprungsraum in angrenzende Räume über einen Luftstrom gelangen. So wird aufgrund von thermischen oder erzwungenen Kräften zum Beispiel über eine Tür oder einen Türspalt Luft zwischen Räumen ausgetauscht. Damit findet auch eine Übertragung von Krankheitserregern zwischen diesen Räumen statt. Soll eine Ausbreitung zwischen Räumen und innerhalb eines Gebäudes vermieden werden, können lüftungstechnische Maßnahmen zum Einsatz kommen, die jedoch mit baulichen Maßnahmen zusammen gedacht werden müssen. So ist es möglich, eine effektive Kohortierung zu realisieren.