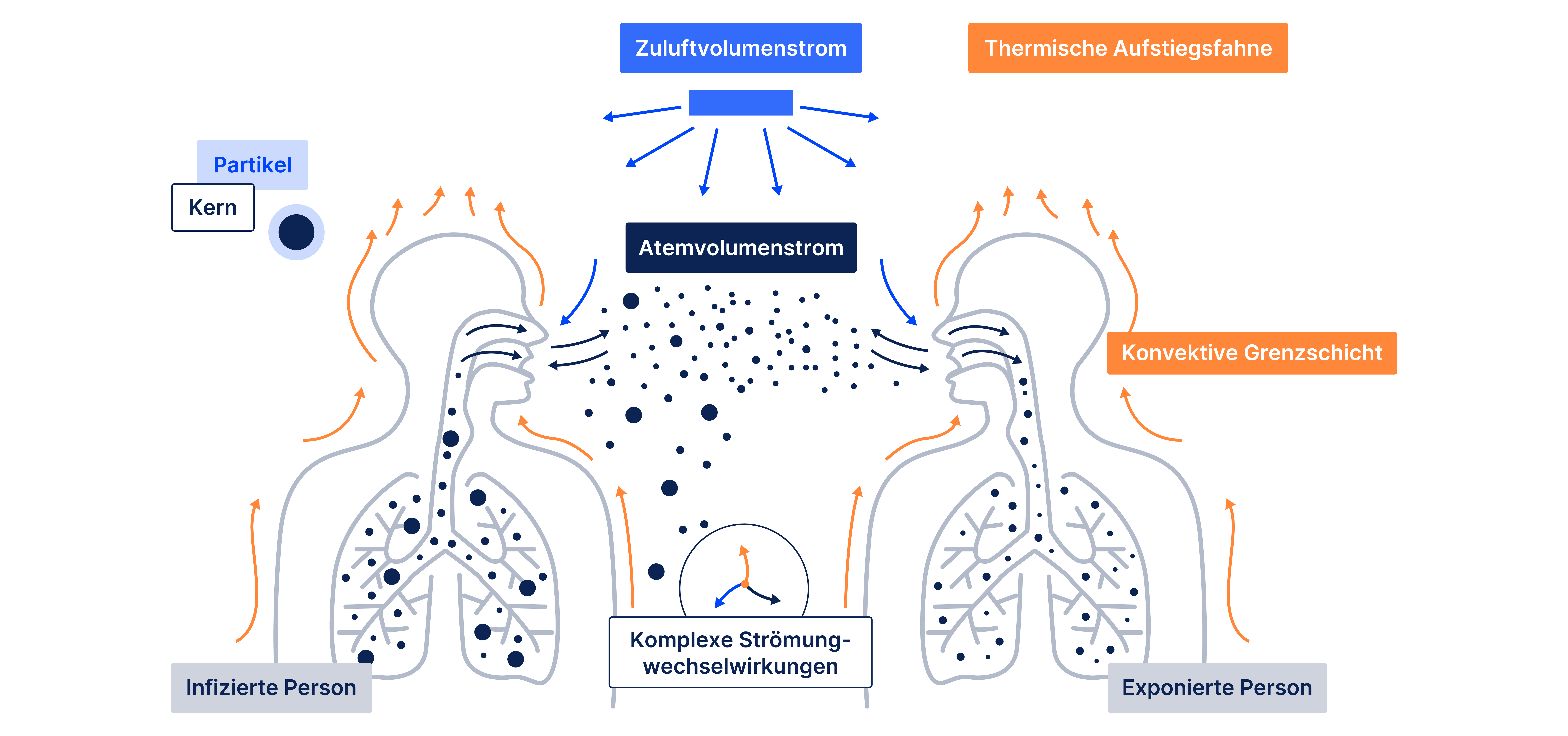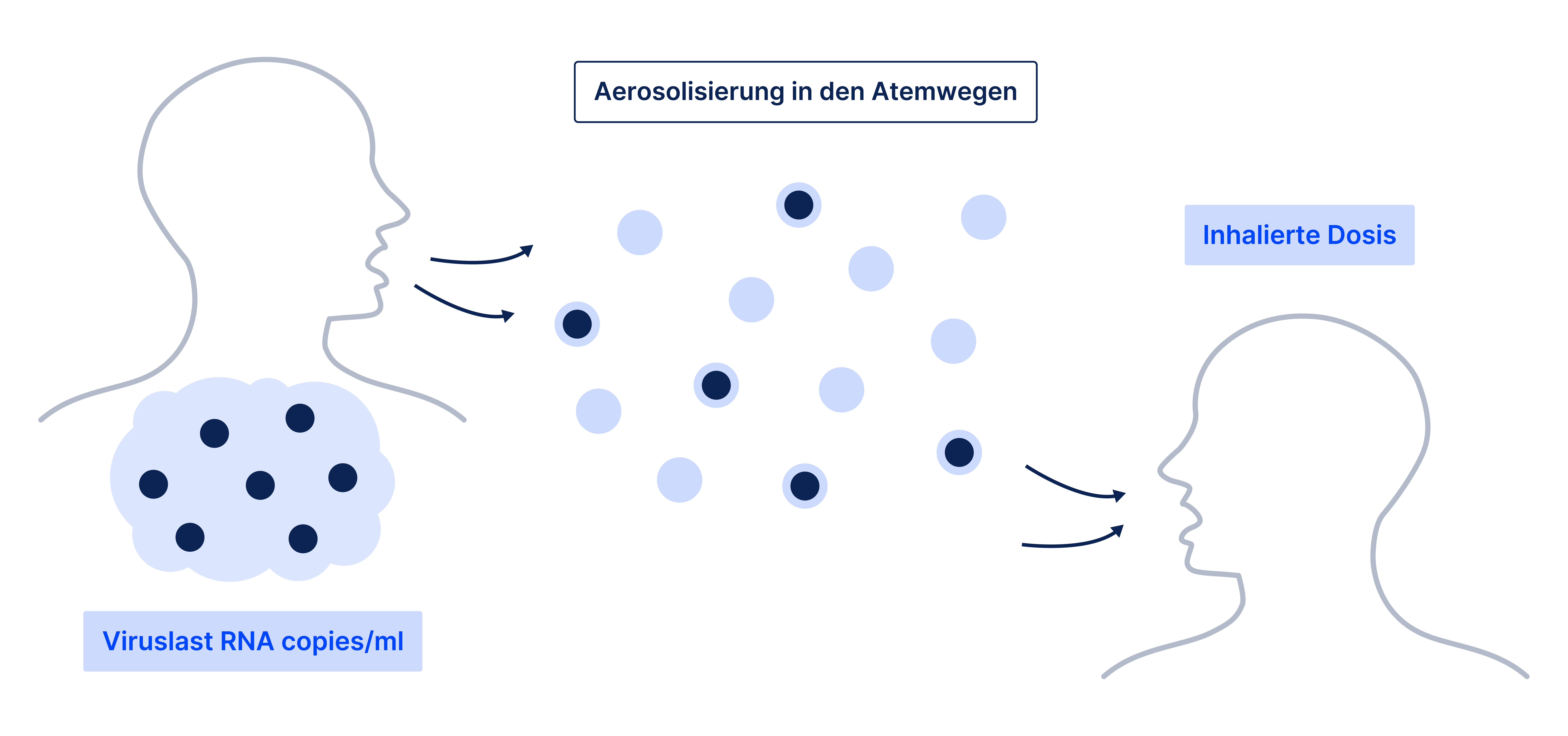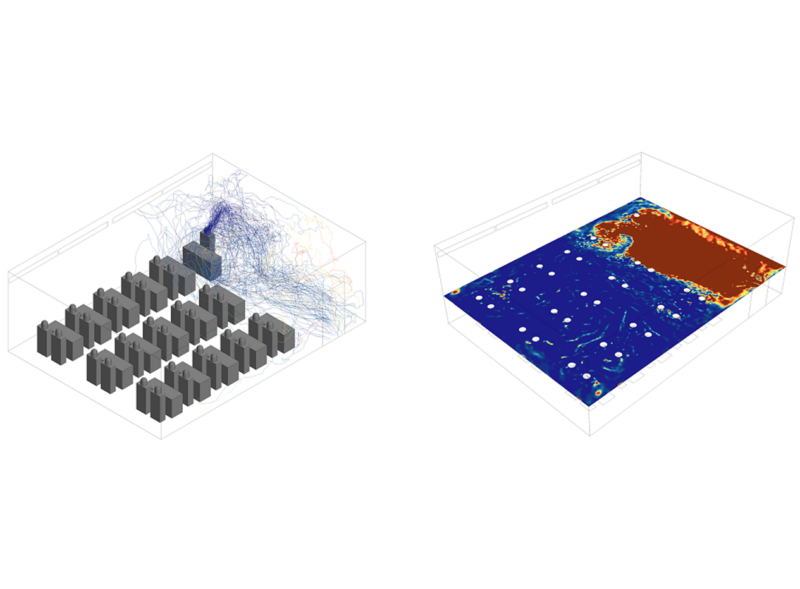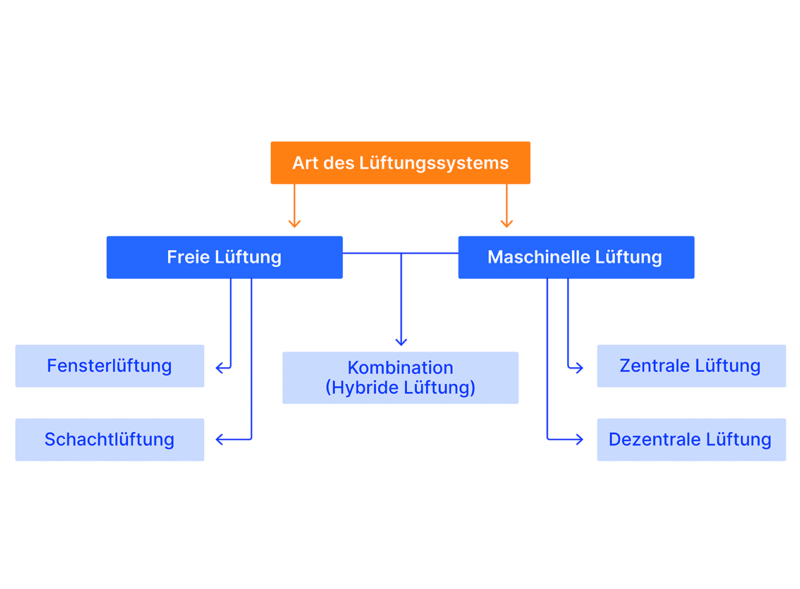Übertragung von Krankheitserregern über die Luft
In diesem Artikel werden die Übertragung von Krankheitserregern über die Luft und ihr Verhalten in der Luft thematisiert. Zudem wird erklärt, wie ihre Konzentration in der Innenraumluft reduziert werden kann. Dies dient dem Verständnis, mit welcher Dringlichkeit infektionsschutzfördernde Maßnahmen und somit der bauliche Gesundheitsschutz betrieben werden müssen.
Hauptübertragungswege von Atemwegsinfektionen
Die Krankheitserreger von Atemwegsinfektionen können sich auf den folgenden drei Hauptwegen verbreiten:
(i) Tröpfchenübertragung,
(ii) Übertragung durch die Luft,
(iii) Übertragung durch Oberflächenkontakt.
Übertragung durch die Luft
Beim Ausatmen, Sprechen, Singen, Schreien, Husten, kurz allen Aktivitäten des Atemtraktes gelangen Partikel in die Luft, die so klein sind, dass sie mit bloßem Auge nicht gesehen werden können. Sie stammen aus verschiedenen Orten der Atemwege und bestehen aus dem die Schleimhäute überziehenden Sekret, das vorwiegend Wasser und Salze beinhaltet. Die sich bei infizierten Personen ebenfalls in den Atemwegen befindenden Erreger werden gemeinsam mit den sehr kleinen Partikeln über die Luft aus dem Körper transportiert. Die meisten dieser Partikel sind sogar so klein, dass sie praktisch in der Luft schweben. Bei der Übertragung durch die Luft werden Erreger eingeatmet, die sich in der Luft befinden.
Zur Auslösung einer über die Luft verursachten Infektion gilt der allgemeine Grundsatz: Je höher die inhalierte Dosis (Anzahl der über die Atmung aufgenommenen Erreger) der exponierten Person, desto höher ist das Infektionsrisiko. Ob eine Infektion tatsächlich ausgelöst wird, hängt von weiteren medizinischen Faktoren ab, z. B. virologischen und immunologischen, und ist damit auch personenabhängig.
Aus dem allgemeinen Grundsatz kann dennoch abgeleitet werden, dass das Infektionsrisiko zum einen von der Anzahl der Erreger in der Luft und zum anderen von der durch die exponierte Person inhalierten Menge an erregerhaltiger Luft beeinflusst wird. Die Anzahl der Erreger in der Luft ist dabei von der Erregerlast (Erreger pro Milliliter Sekret) in den Atemwegen und von der Partikelproduktion (aus dem erregerhaltigen Sekret) der infizierten Person abhängig. Die Partikelproduktion ist sowohl alters- als auch aktivitätsabhängig. So wächst die Produktionsrate von Kindern zu Erwachsenen und vom Atmen über Sprechen zum Schreien und Singen. Auf der anderen Seite wird die Menge an inhalierter erregerhaltiger Luft durch den Atemvolumenstrom und die Expositionsdauer beeinflusst.
Verhalten der luftgetragenen Erreger im Raum
Durch eine infizierte Person in den Raum ausgestoßene, erregerbehaftete Partikel sind in der Regel sehr gut luftgetragen, d. h. sie schweben praktisch. Diese Partikel verbreiten sich hauptsächlich durch die sich im Raum einstellenden Raumluftströmungen. Raumluftströmungen sind zeitabhängig und dreidimensional. Sie bilden sich durch erzwungene Kräfte (z. B. Zulufteinbringung über Fensteröffnung oder Lüftungsanlagen, Ventilator, Personenbewegung) und natürliche Kräfte (Thermik) aus, bspw. durch aufsteigende, von einem Heizkörper oder von Personen erwärmte Luft. Je nach Situation und örtlichen Randbedingungen dominieren erzwungene oder thermische Kräfte, oftmals wirken sie zusammen und sind z. T. von gleicher Größenordnung. Ort und Art der Zulufteinbringung, der Wärmequellen und -senken (z. B. kalte Flächen, wie Innenoberflächen von Außenfenstern im Winter) sowie Raumumschließungsflächen und Möbel beeinflussen das Raumströmungsbild. Für die Ausbreitung und Verteilung von luftgetragenen Partikeln sind darüber hinaus der Ort der Emissionsquelle und die Position der Zu- und Abluft entscheidend. In der Praxis bedeutet diese Komplexität, dass eine Vorhersage des Ausbreitungsverhaltens nur grob qualitativ bestimmt werden kann.
Die mittleren Raumluftgeschwindigkeiten in Innenräumen liegen etwa zwischen 1 und 20 cm pro Sekunde, innerhalb von Jets, die einem Zuluftstrahl oder Auftriebsstrom oberhalb von Wärmequellen entsprechen, teilweise deutlich höher. Diese Luftgeschwindigkeiten bedeuten, dass sich luftgetragene Partikel schnell über weite Strecken ausbreiten. Wird von einer mittleren Luftgeschwindigkeit im Raum in Höhe von 5 cm pro Sekunde ausgegangen, dann legen die Partikel etwa eine Strecke von 3 m pro Minute zurück. Das bedeutet, dass die Partikel und damit die Erreger innerhalb kurzer Zeit überall im Raum verteilt werden.
Aufgrund der Abhängigkeit des Ausbreitungsverhaltens von diversen Faktoren entsteht in der Realität keine homogene Verteilung der erregerbehafteten Partikel. Es gibt lokal zum Teil deutliche Konzentrationsunterschiede von größer 100 %. In der Nähe der Emissionsquelle, dem Nahfeld, ist statistisch gesehen die Konzentration stets höher als weiter entfernt im Fernfeld.
Nah- und Fernfeld
Das direkte Nahfeld ist das Konzentrationsfeld innerhalb der unmittelbaren Ausatemluft, z. B. zwischen zwei einander zugewandten Personen mit kleinem Abstand. Das indirekte Nahfeld stellt sich hingegen durch die Raumluftströmung ein. Dies bedeutet, dass sich ein Feld deutlich erhöhter Konzentration im Nahbereich der erregerausstoßenden Person bildet. Dabei kann die Ausatemluft über einen Umweg, z. B. über die Decke und die Wand, wieder in den Atembereich von nahen Personen gelangen. Dieses indirekte Nahfeld kann eine Größe von drei bis fünf Metern annehmen. Unter einem Fernfeld wird der Rest des Raumes verstanden, der nicht einem direkten oder indirekten Nahfeld entspricht.
Reduzierung der Erregerlast in der Innenraumluft
Zur Reduktion der replizierfähigen Erreger in der Raumluft gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: die Inaktivierung, z. B. durch UV-Strahlung, und den Abtransport über Be- und Entlüftung aus einem Raum heraus. UV-Bestrahlung ist zwar grundsätzlich als wirksam anzusehen, jedoch ist sie für die Behandlung der Raumluft noch nicht standardisiert, da bei der Nutzung keine einheitlichen Prüfverfahren und Sicherheitsbedingungen definiert sind. Sie ist Gegenstand einiger Forschungsarbeiten zur Wirksamkeit und zu negativen Auswirkungen der UV-Strahlen auf den Menschen. Die klassische Be- und Entlüftung und damit die Abfuhr von kontaminierter Luft aus dem Raum/Gebäude entspricht hingegen dem Stand der Technik und wird seit Jahrzehnten in Räumen mit hohen Reinheitsanforderungen (Sicherheitslabore, Medikamentenproduktion, Räume des Gesundheitswesens, Chipproduktion etc.) erfolgreich eingesetzt.
Internationale und nationale Organisationen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) und die Federation of European Heating, Ventilating and Air Conditioning Association (REHVA), der Verein Deutscher Ingenieure (VDI), sowie nationale Ämter (z. B. Umweltbundesamt (UBA)), Behörden (z. B. Robert Koch-Institut (RKI) und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)) und Verbände (z. B. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) und Fachverband Gebäude-Klima (FGK)) haben Vorschläge und Richtlinien zur Minderung der Übertragung des Coronavirus (SARS-CoV-2) veröffentlicht. Allen Empfehlungen gemein ist, dass so viel Außenluft wie möglich von außen zugeführt und damit erregerhaltige Luft abgeführt werden sollte, um das Infektionsrisiko über die Luft zu senken.
In diesem Zusammenhang kommt der Bewertung des Infektionsrisikos eine besondere Bedeutung zu, die dabei helfen kann, die Effizienz der entsprechenden Infektionskontrollstrategien zu quantifizieren und zu bewerten.
Weitere verwandte Artikel